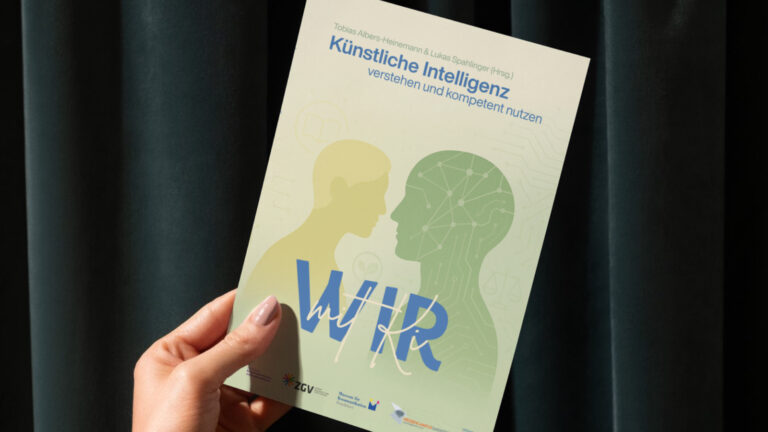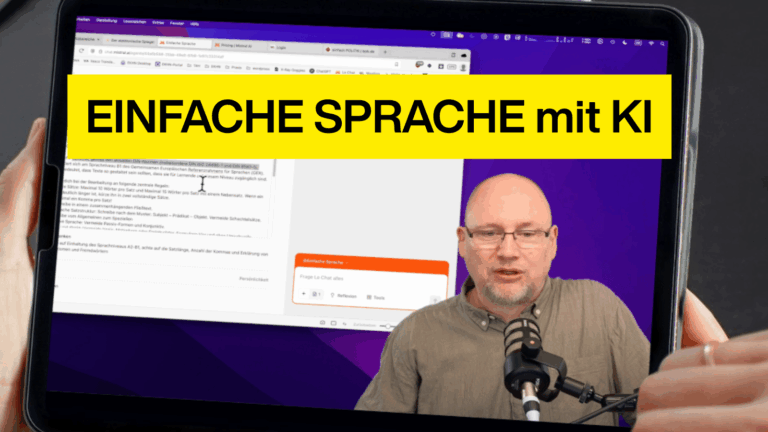Ein neues Urteil des Bundesgerichtshofs (BGH, III ZR 109/24 vom 12. Juni 2025) hat in der Fort- und Weiterbildungswelt für Aufsehen gesorgt. Für viele Menschen ist zunächst unklar, warum ein Gericht überhaupt über Lernformate wie Online-Kurse oder Coachings entscheidet. Hintergrund ist das Fernunterrichtsschutzgesetz (FernUSG). Dieses Gesetz soll sicherstellen, dass Bildungsangebote, die nicht in Präsenz stattfinden, bestimmte Qualitätsstandards einhalten und die Teilnehmenden geschützt sind – etwa vor unseriösen Versprechen oder überhöhten Kosten. Unter Präsenz versteht man dabei nicht nur das gemeinsame Lernen in einem physischen Raum, sondern auch Online-Formate in Echtzeit, wie etwa Live-Video-Seminare oder Zoom-Sessions, die rechtlich wie Präsenzveranstaltungen behandelt werden, solange eine direkte Interaktion möglich ist.
Auf den ersten Blick betrifft das Urteil ein teures Business-Mentoring-Programm. Auf den zweiten Blick geht es aber um etwas viel Grundsätzlicheres: Der BGH stellt klar, dass auch Coaching- oder Mentoring-Angebote unter das FernUSG fallen können, wenn bestimmte Kriterien erfüllt sind.
Für alle, die in der Erwachsenenbildung tätig sind, wirft das sofort Fragen auf: Welche Formate sind künftig zulassungspflichtig, welche nicht? Gilt das auch für Blended Learning, also die Mischung aus Präsenz und Online-Lernen? Was ist mit reinen Selbstlernkursen, die viele Einrichtungen anbieten? Muss jetzt jede*r, der ein Lernvideo hochlädt, einen Antrag bei der ZFU stellen? Genau an diesen Schnittstellen zwischen rechtlichen Vorgaben und alltäglicher Bildungspraxis wird deutlich, dass es letztlich um die Frage geht, wie moderne Erwachsenenbildung rechtssicher gestaltet werden kann – ohne dabei die Flexibilität und Vielfalt der Formate zu verlieren.
Blended Learning und Selbstlernkurse – kurz erklärt
Blended Learning heißt wörtlich „vermischtes Lernen“. Gemeint ist die Kombination von klassischen Präsenzseminaren mit digitalen Elementen. Ein Beispiel: Ein Kurs beginnt mit einem Präsenzworkshop, dann arbeiten die Teilnehmenden online an Aufgaben weiter und treffen sich zwischendurch in Zoom-Sessions.
Selbstlernkurse dagegen sind Formate, bei denen Materialien wie Videos, Podcasts oder Arbeitsblätter bereitgestellt werden. Die Teilnehmenden arbeiten diese selbstständig durch, oft unterstützt von Chats, Foren oder Feedbackmöglichkeiten.
Diese beiden Formate sind inzwischen fester Bestandteil der Erwachsenenbildung – und genau hier setzt das Urteil an.
Wann wird ein Kurs zum „Fernunterricht“?
Das FernUSG unterscheidet nicht zwischen „klassischer Weiterbildung“ und „moderner Erwachsenenbildung“. Entscheidend sind drei Merkmale:
- Es wird Wissen oder Können vermittelt (von Excel-Tipps über Kommunikationsmethoden bis hin zu Persönlichkeitsentwicklung).
- Die Lernenden und Lehrenden sind überwiegend räumlich getrennt. Live-Online-Sessions gelten als synchron (wie Präsenz), aber aufgezeichnete Webinare zählen als asynchron.
- Es gibt eine Lernerfolgskontrolle. Schon die Möglichkeit, Fragen zu stellen und Antworten zu bekommen, reicht aus.
Sind diese drei Punkte erfüllt, liegt in der Regel ein Fernunterricht vor – unabhängig davon, ob es sich um ein Business-Coaching, ein Online-Seminar oder einen Selbstlernkurs handelt.
Die fünf Prüffragen der ZFU
Die ZFU (Zentralstelle für Fernunterricht) bietet ein Prüftool an. Ein einziges Nein genügt, und keine Zulassung ist erforderlich. Fünfmal Ja bedeutet: Zulassungspflicht.
- Entstehen den Teilnehmenden Kosten?
- Wird ein Vertrag geschlossen?
- Werden Kenntnisse und Fähigkeiten vermittelt (auch Tipps oder persönliche Erfahrungen)?
- Findet eine Lernerfolgskontrolle statt (z. B. Fragen im Chat, Feedback per Mail)?
- Überwiegt der asynchrone Anteil (mehr als 50 % Selbstlernmaterialien, Videos, Aufzeichnungen)?
Zum Tool: https://zfu.de/veranstaltende/zulassung
Achtung: Auch Verträge mit Unternehmen sind betroffen
Der BGH hat klargestellt: Das Gesetz gilt auch für Unternehmer*innen (§ 14 BGB). Das bedeutet: Auch wenn eine Weiterbildung gezielt an Selbstständige, Führungskräfte oder Unternehmen verkauft wird, kann eine Zulassungspflicht bestehen. Selbst innerbetriebliche Fortbildungen sind nicht automatisch ausgenommen.
Formate anpassen – oder Zulassung beantragen
Zwei Stellschrauben für Anbieter*innen:
- Angebote komplett synchron durchführen – also nur live, ob online oder vor Ort.
- Oder darauf achten, dass der synchrone Anteil über 50 % liegt.
Sind alle fünf Kriterien erfüllt, führt kein Weg an der ZFU vorbei – dann ist eine Zulassung erforderlich, verbunden mit Gebühren.
Ein Realitätscheck aus der Praxis
Im Zentrum Bildung der EKHN – Fachbereich Erwachsenen- und Familienbildung wurden alle Online- und Blended-Learning-Kurse mit dem ZFU-Tool geprüft. Das Ergebnis war eindeutig: Keiner der Kurse ist zulassungspflichtig. Dafür gibt es mehrere Gründe. Zum einen sind viele Angebote grundsätzlich kostenfrei, was bereits ein entscheidendes Ausschlusskriterium für die Zulassungspflicht darstellt. Zum anderen wird bei kostenpflichtigen Veranstaltungen konsequent darauf geachtet, dass der synchrone Anteil – also Live-Seminare, Präsenzphasen oder interaktive Online-Sessions – deutlich über 50 % liegt. Gerade diese Gestaltung sichert, dass Lernende nicht auf sich allein gestellt bleiben, sondern in einen kontinuierlichen Austausch eingebunden sind.
Dieses Beispiel macht deutlich: Nicht jedes Online-Format fällt automatisch unter die Zulassungspflicht. Dennoch lohnt es sich für Bildungsträger, die eigenen Angebote genau unter die Lupe zu nehmen. Das ZFU-Tool bietet hier eine praxisnahe Orientierungshilfe, um die Balance zwischen rechtlicher Sicherheit und pädagogischer Freiheit zu halten. So können Einrichtungen sicherstellen, dass sie ihre Angebote flexibel und innovativ gestalten – ohne dabei ungewollt in die Zulassungspflicht zu geraten.
Fazit und Hinweis
Das Urteil des BGH ist ein Weckruf: Auch die Erwachsenenbildung muss das FernUSG ernst nehmen. Besonders Formate mit starkem Selbstlernanteil oder aufwendigen Begleitprogrammen sollten geprüft werden – und zwar nicht nur im Verbrauchermarkt, sondern auch bei Angeboten für Unternehmen. Für Bildungsträger bedeutet dies, die eigenen Konzepte strategisch zu hinterfragen: Sind Selbstlernmaterialien nur ein ergänzender Baustein oder das tragende Element? Wird der Austausch zwischen Lehrenden und Lernenden ausreichend gesichert? Und welche Konsequenzen entstehen für klassische Formate wie Sprachkurse, IT-Trainings oder Coachings, wenn Teile davon aufgezeichnet und zum späteren Abruf bereitgestellt werden?
Diese Fragen sind nicht nur theoretischer Natur, sondern betreffen die tägliche Praxis in Volkshochschulen, kirchlichen Bildungseinrichtungen und privaten Akademien. Wer rechtzeitig prüft und gegebenenfalls Anpassungen vornimmt, kann sein Angebot weiterhin flexibel gestalten und gleichzeitig rechtliche Sicherheit gewinnen.
Rat: Den ZFU-Check machen – am besten sofort. Und wenn Unsicherheit besteht, juristischen Rat einholen.
Alle Angaben sind sorgfältig recherchiert, ersetzen aber keine Rechtsberatung. Alle Angaben ohne Gewähr.